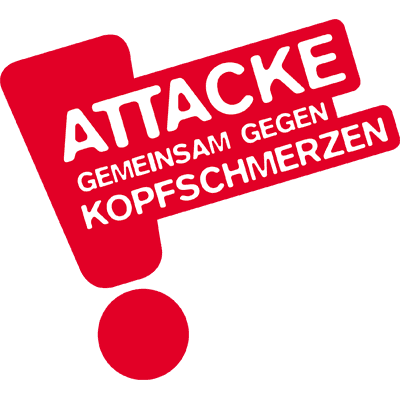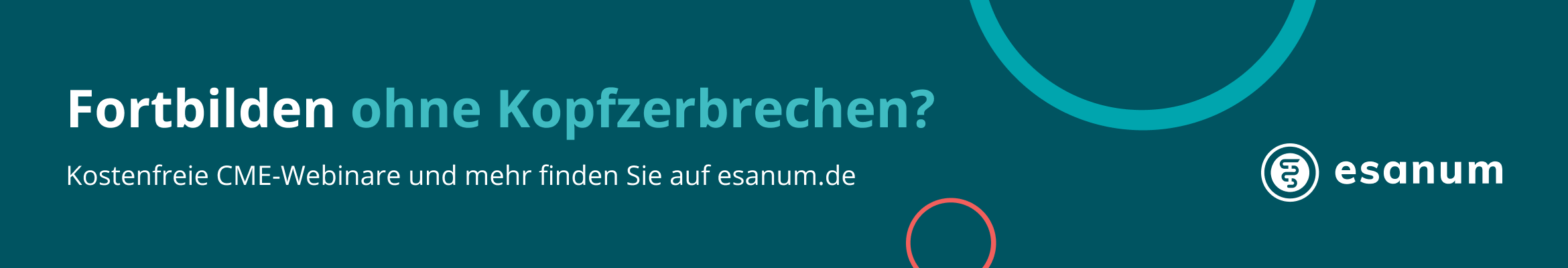Basiswissen
Alle „herkömmlichen“ migräneprophylaktischen Substanzen wie Amitriptylin, Betarezeptorenblocker, Candesartan, Flunarizin und Topiramat wurden ursprünglich für eine andere Indikation entwickelt, was bei Patienten häufig zu Verunsicherung führt. Diese anderen Wirkmechanismen können jedoch bei bestimmten Komorbiditäten ein Vorteil für den Patienten sein und sollten genutzt werden:
Die Angiotensinrezeptor-Blocker Candesartan und Telmisartan können bislang nur off-label zur Migräneprophylaxe eingesetzt werden, haben ihre Wirksamkeit jedoch in kontrollierten Studien gezeigt. Sartane sind ebenso wie ein Betarezeptorenblocker besonders geeignet bei Patienten mit begleitender arterieller Hypertonie.
Betarezeptorenblocker sind zudem besonders geeignet bei tachykarden Rhythmusstörungen oder Vorliegen eines essenziellen Tremors. Betarezeptorenblocker können aber eine vorbestehende Psoriasis verschlechtern und sollten deswegen vorsorglich nicht bei Psoriasis eingesetzt werden. Auch kann es bei männlichen Patienten zu Erektionsstörungen kommen.
Das Antikonvulsivum Topiramat kann zu deutlichen Stimmungsschwankungen mit Ängsten und depressiven Verstimmungen führen. Es sollte daher bei vorbekannten affektiven Störungen nur nach sorgfältiger Aufklärung unter Abwägung von Nutzen und Risiko verordnet werden. Zudem kann Topiramat zu einer Gewichtsabnahme führen. Es kann daher bei übergewichtigen Patienten eine Option darstellen, sollte aber bei Anorexie vermieden werden. Jedoch müssen die Einschränkungen zur Anwendung berücksichtigt werden. Topiramat ist zur Migräneprophylaxe in der Schwangerschaft und bei Frauen im gebärfähigen Alter, die keine hochwirksame Empfängnisverhütung anwenden, kontraindiziert. Es muss während der Behandlung und für mindestens 4 Wochen nach Beendigung der Behandlung mit Topiramat eine hochwirksame Verhütungsmethode angewandt werden. Patienten sollten hierüber explizit aufgeklärt werden.
Aufgrund der affektstabilisierenden Eigenschaften kann das Antikonvulsivum Valproinsäure bei Migränepatienten mit begleitender Depression oder bipolaren affektiven Störungen günstig sein. Es darf aber nur noch off-label zur Migräneprophylaxe und nur noch bei Patienten, bei denen keine Schwangerschaft möglich ist, eingesetzt werden. Jedoch gibt es auch neue Daten, dass durch eine Therapie mit Valproat auch bei den Vätern eine erhöhte Gefahr für das ungeborene Kind besteht. Daher müssen auch männliche Patienten über das potenzielle Risiko neurologischer Entwicklungsstörungen bei Kindern informiert und mit ihnen die Notwendigkeit besprochen werden, dass während der Anwendung von Valproat und für drei Monate nach Beendigung der Behandlung eine zuverlässige Empfängnisverhütung für ihn und die Partnerin notwendig ist. Wenn möglich sollte auf Valproat, wenn die Migränetherapie im Vordergrund steht, aufgrund von nebenwirkungsärmeren Alternativen verzichtet werden.
Amitriptylin ist das Mittel der Wahl bei Patienten mit begleitenden Schlafstörungen, depressiver Störung oder/und einer Angststörung, sofern keine Kontraindikationen (wie zum Beispiel Glaukom, Blasenentleerungsstörungen, Herzrhythmusstörungen, Adipositas) vorliegen.
Flunarizin kann zu extrapyramidal-motorischen Störungen, Gewichtszunahme und depressiven Verstimmungen führen. Über das potenzielle Auftreten dieser nach Absetzen reversiblen Nebenwirkungen sollte immer aufgeklärt werden. Liegen entsprechende Komorbiditäten vor, ist Flunarizin zu vermeiden. Asthma bronchiale stellt keine Kontraindikation für die Gabe von Flunarizin dar.
Ein Kopfschmerz zurückzuführen auf einen Medikamentenübergebrauch (MOH) kann als sekundärer Kopfschmerz insbesondere bei chronischen Kopfschmerzerkrankungen wie der chronischen Migräne auftreten. Eine Wirksamkeit der zugelassenen Prophylaktika ist insbesondere für Topiramat, Onabotulinumtoxin A und CGRP-(Rezeptor)-Antikörper nachgewiesen. Topiramat ist jedoch (wie oben erwähnt) nur eingeschränkt einsetzbar.
Das sollte man wissen
Es ist hilfreich darüber zu informieren, dass die nicht-migränespezifischen oralen Prophylaktika für eine ursprünglich andere Indikation entwickelt wurden, dass die Verordnung aber primär zur Migräneprophylaxe erfolgt und dass die gewählte Substanz ihre migräneprophylaktische Wirkung auch in entsprechenden wissenschaftlichen Studien bewiesen hat.
Empfehlung für Ärzte
Die Auswahl der migräneprophylaktischen Substanz sollte begleitende Komorbiditäten eines Patienten immer berücksichtigen. Zwei Erkrankungen mit einer einzigen Substanz zu behandeln ist immer besonders elegant und erhöht bei vielen Patienten auch die Compliance.
Referenz
Diener H.-C., Förderreuther S, Kropp P. et al., Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne, S1-Leitlinie, 2022, DGN und DMKG, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 10.01.2025)
Letzte Aktualisierung: 16. Januar 2025
Autor: Priv.-Doz. Dr. med. Stefanie Förderreuther, Dr. med. Armin Scheffler